Grüner Wasserstoff in Brasilien: Vom Versprechen zur wirtschaftlichen und industriellen Realität
- Fernando Caneppele

- 24. Juli
- 5 Min. Lesezeit
Von Prof. Fernando Caneppele (Universität São Paulo)

Juli 2025
Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment für die Energie- und Industriepolitik Brasiliens. In einem globalen Umfeld, das von der dringenden Suche nach Energiesicherheit und widerstandsfähigen Lieferketten geprägt ist, hat sich der Übergang zu sauberen Energiequellen von einer rein ökologischen Agenda zu einer Säule moderner Geopolitik entwickelt.
Mit der bevorstehenden COP30 in Belém richtet sich der Blick der Welt auf Brasilien – nicht nur als Hüter wichtiger Biome, sondern auch als potenzieller Hauptakteur in der neuen dekarbonisierten Wirtschaft. Diese Situation erzeugt einen doppelten Druck: den „externen Druck“ der internationalen Nachfrage nach Dekarbonisierung und den „internen Druck“, unsere eigene Reindustrialisierung, Innovation und Energiesicherheit voranzutreiben.
In diesem Kontext ist kein Thema so symbolträchtig für unser Potenzial und unsere Herausforderungen wie grüner Wasserstoff (H2V). Über Jahre hinweg wurden Brasiliens komparative Vorteile diskutiert: ein Strommix mit niedrigem CO₂-Ausstoß, reichlich Sonne und Wind sowie große territoriale Ausdehnung. Das Versprechen, diese natürlichen Gaben in eine globale Führungsrolle bei der H2V-Produktion zu verwandeln, nährte Absichtserklärungen und zahlreiche Kongresse. Heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob Brasilien eine führende Rolle übernehmen kann, sondern wie wir den Übergang vom Versprechen zur industriellen und wirtschaftlichen Realität schaffen.
H2V sollte nicht als einfache Ware betrachtet werden, sondern als „Plattform-Molekül“ – als Grundlage für den Aufbau eines neuen, hochentwickelten industriellen Ökosystems. Die Phase der Potenzialstudien weicht nun der Dringlichkeit der Umsetzung. Der Erfolg wird von einem pragmatischen Ansatz abhängen, der sich auf Herausforderungen in Bezug auf Skalierung, Kosten, Marktentwicklung, Infrastruktur und – entscheidend – den Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wertschöpfungskette konzentriert.
Die Herausforderung der Skalierung und die Kostenwettbewerbsfähigkeit
Die Realisierbarkeit von grünem Wasserstoff ist in erster Linie eine Frage der Skalierung und der Kostenstruktur. Der entscheidende Indikator ist der Levelized Cost of Hydrogen (LCOH) – der die Kosten für erneuerbaren Strom, Investitionen in Elektrolyseure (CAPEX), Betriebs- und Wartungskosten (OPEX) sowie den Kapazitätsfaktor der Anlage umfasst. Und genau hier verfügt Brasilien über einen doppelten Wettbewerbsvorteil: Der Preis für erneuerbare Energie ist nicht nur niedrig, sondern insbesondere im Nordosten des Landes gehören die Kapazitätsfaktoren unserer Windparks zu den höchsten weltweit. Das erlaubt eine längere Betriebszeit der teuren Elektrolyseure und somit eine effizientere Kostenverteilung pro Kilogramm produziertem Wasserstoff.
Dennoch bleibt der CAPEX für Elektrolyseure das größte Hindernis. Die Wahl der Technologie – sei es das ausgereiftere alkalische Verfahren (ALK), das flexiblere Verfahren mit Protonenaustauschmembran (PEM) oder die aufkommende Festoxid-Technologie (SOEC) – hat Auswirkungen auf Kosten, Wirkungsgrad und die Abhängigkeit von kritischen Mineralien wie Platin und Iridium. Die globale Lieferkette für diese Technologien ist derzeit stark in China und Europa konzentriert, was unser noch junges Programm Risiken wie Preisschwankungen und logistische Engpässe aussetzt.
Die Verabschiedung des brasilianischen Wasserstoffgesetzes (Gesetz Nr. 14.948/2024) war ein entscheidender Schritt, um die rechtliche Sicherheit zu schaffen, die für die Freisetzung geplanter Investitionen in Milliardenhöhe notwendig ist. Nun muss die nationale Entwicklungsbank BNDES über die direkte Finanzierung hinausgehen und als Katalysator fungieren – durch blended finance-Mechanismen und Garantien, um auch vorsichtige private und internationale Investoren zu gewinnen. 2025 dürfte das Jahr sein, in dem die ersten Großprojekte in Industriehäfen wie Pecém (CE) und Açu (RJ) in die Phase finaler Investitionsentscheidungen eintreten.
Marktentwicklung: Lokale Verankerung und globale Sichtbarkeit
Eine erfolgreiche Marktstrategie für H2V muss dual sein: einerseits auf den Export ausgerichtet, andererseits auf die Etablierung eines starken Inlandsmarkts.
Der Exportmarkt ist die internationale Visitenkarte, die große Investoren anzieht. Die Europäische Union, mit ihren neuen strengen Regularien, kauft nicht einfach nur Wasserstoff, sondern „erneuerbare nicht-biogene Kraftstoffe“ (RFNBOs), die strenge Kriterien bezüglich Zusätzlichkeit sowie zeitlicher und geografischer Korrelation erfüllen müssen. Unsere Produktion muss daher über ein robustes Zertifizierungssystem verfügen, das ihre „grüne“ Herkunft belegt – ein technischer und bürokratischer Kraftakt.
Die Umwandlung von H2V in besser transportierbare Derivate wie grünes Ammoniak oder grünes Methanol ist dabei ein pragmatischer Weg, bringt jedoch zusätzliche Kosten und Effizienzverluste mit sich. Der Wettbewerb mit anderen Ländern wie Chile, Australien und Staaten des Nahen Ostens macht Geschwindigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu kritischen Faktoren.
Doch der Inlandsmarkt ist das eigentliche Rückgrat unserer H2V-Industrie. Die Produktion auf eine kalkulierbare lokale Nachfrage zu stützen, ist strategisch klug und verringert die Anfälligkeit für Wechselkurs- und geopolitische Schwankungen. Die größte Chance liegt darin, mit H2V unsere eigene Industrie zu dekarbonisieren. Für die Agrarwirtschaft, die Milliarden in Form von importierten Stickstoffdüngern ausgibt, bedeutet die lokale Produktion von grünem Ammoniak ein Element der Ernährungssicherheit.
Für die Stahlindustrie bietet H2V im Direktreduktionsverfahren (DRI) die Möglichkeit zur Herstellung von „grünem Stahl“ – einem Produkt mit hohem Mehrwert und wachsender internationaler Nachfrage. Das neue Programm zur Entwicklung kohlenstoffarmen Wasserstoffs (PHBC) mit seinen Steueranreizen ist ein geeignetes Instrument, um diesen Wandel zu fördern – einschließlich künftiger Anwendungen in der Luft- und Schifffahrt über synthetische Kraftstoffe.
Die Logistik einer neuen Energie
Die Wasserstoffmoleküle sind klein und energiereich, aber berüchtigt schwer zu speichern und zu transportieren. Die Logistik ist womöglich die Achillesferse der kontinentweiten Wasserstoffwirtschaft. Die Beförderung von H2V aus dem Nordosten zu Industriezentren im Südosten oder zu Exporthäfen erfordert eine monumentale logistische Umstrukturierung.
Die Umrüstung bestehender Gaspipelines ist technisch herausfordernd – etwa wegen der sogenannten Wasserstoffversprödung, die das Stahlmaterial schwächt, sowie der Notwendigkeit neuer Verdichterstationen. Der Bau eines völlig neuen Netzes von Wasserstoffleitungen ist langfristig die ideale Lösung, erfordert jedoch enorme Investitionen und Jahrzehnte Planungszeit. Das stärkt das Argument für eine initiale Entwicklung auf Basis von „Hubs“ oder „Clustern“.
Häfen wie Pecém und Açu positionieren sich nicht nur als Exportterminals, sondern als integrierte Ökosysteme, in denen Offshore-Erzeugung erneuerbarer Energie, H2V-Produktion, Ammoniaksynthese und industrielle Nutzung (z. B. Stahl-, Zement- und Chemieindustrie) auf engem Raum koexistieren. Dieses Co-Location-Modell minimiert den Transportbedarf, schafft Skaleneffekte und optimiert die gesamte Wertschöpfungskette. Zusätzlich müssen geologische Speichermethoden wie Salzstock-Kavernen untersucht werden, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Wertschöpfungskette: Von der Rohware zur technologischen Souveränität
Die größte Gefahr für Brasilien wäre es, sich mit der Rolle eines neokolonialen Exporteurs einer billigen grünen Molekül-Rohware zufriedenzugeben. Die schmerzhafte Lektion aus der Photovoltaikbranche – in der wir zu massiven Importeuren ausländischer Technologie wurden – darf sich nicht wiederholen. Die strategische Chance, das Herzstück einer Industriepolitik für das 21. Jahrhundert, liegt im Aufbau einer nationalen Wertschöpfungskette rund um H2V.
Das bedeutet gezielte Förderung der inländischen Herstellung zentraler Komponenten wie Elektrolyseure, Brennstoffzellen, Speichertanks und Steuerungssysteme – durch klare Industriepolitik, lokale Beschaffungsvorgaben und Technologietransferanforderungen. Staatliche Förderprogramme wie das PHBC und öffentliche Beschaffungen sollten als Hebel dienen, um globale Hersteller zur lokalen Produktion zu bewegen und gleichzeitig brasilianische Unternehmen zu befähigen, wettbewerbsfähig zu werden.
Der Technologietransfer senkt nicht nur langfristig die Kosten, sondern schafft qualifizierte Arbeitsplätze und ermöglicht die Entwicklung eigener Exportkapazitäten für Ausrüstungen und Ingenieurdienstleistungen. Parallel dazu ist eine nationale Mobilisierung zur Ausbildung von Fachkräften unerlässlich – wir brauchen eine Generation von Ingenieur:innen, Chemiker:innen, Sicherheitsexpert:innen und Techniker:innen, die „wasserstoffbereit“ sind. Dies erfordert beispiellose Kooperationen zwischen Industrie, Regierung und Bildungsinstitutionen.
Schlussfolgerung
Brasilien steht Mitte 2025 an der Schwelle zu einer neuen Energie- und Industrieära. Die wesentlichen Grundlagen sind gelegt: ein regulatorischer Rahmen, finanzierte Großprojekte und eine marktorientierte Strategie. Jetzt ist die Stunde der kompromisslosen Umsetzung, der Koordination und der langfristigen Vision.
Die Verwirklichung des Potenzials von grünem Wasserstoff als industrielle und wirtschaftliche Realität ist das Gebot der Stunde – eine historische Chance, Brasilien nachhaltig zu reindustrialisieren und auf der geopolitischen Energielandkarte dauerhaft zu verankern. Der Weg dorthin ist komplex, technisch anspruchsvoll und kapitalintensiv. Aber Stillstand wäre ein historischer Fehler von unermesslichem Ausmaß. Der Aufbau dieser Zukunft erfordert nationalen Konsens und einen unerschütterlichen Willen, unser Potenzial endlich in Wohlstand und Einfluss zu verwandeln.
Grüner Wasserstoff in Brasilien: Vom Versprechen zur wirtschaftlichen und industriellen Realität


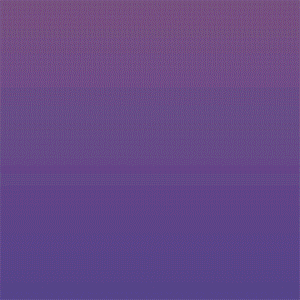






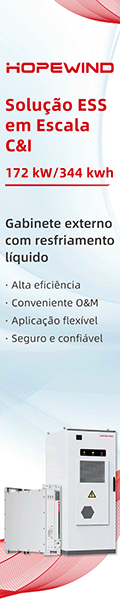
Kommentare